|
Misstrauische Patienten,
Unerfüllbare Vorgaben
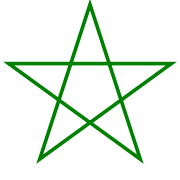
"Ständig werden PATIENTEN dazu
aufgefordert, ihren ÄRZTEN zu misstrauen.
Sie auf die optimale Erfüllung ihrer Aufgaben hin zu überprüfen. Sich zu
fragen, ob
sie wirklich bestmöglich behandelt werden. Das
Recht auf bestmögliche Behandlung
soll immer und überall zu Anwendung kommen.
In der THEORIE stellt weder diese Forderung noch deren Erfüllung ein
Problem dar.
In der PRAXIS stehen sich aber vom Gesetzgeber nicht vorgesehene
Situationen und unerfüllbare
juridische Ansprüche gegenüber. Bei einem Autobusunfall mit zig
Schwerverletzten wird die Behandlungs-
qualität trotz bester Alarmierungsmaßnahmen eine andere sein müssen, als
sie einem einzelnen schwer-
verletzten Patienten zu Teil werden kann. Eine Grippeepidemie wird
sowohl Spitalskapazitäten als auch die
Systemressourcen im niedergelassenen Bereich an juridisch nicht
vorgesehene Grenzen stoßen lassen.
So heißt es im Einzelvertrag zwischen Arzt und Krankenkasse: "Der
Aufforderung zur Visite
ist Folge zu leisten." - Wenn aber zu Grippezeiten 45 Patienten pro
Tag um einen Arztbesuch
bitten, so ist es dem Arzt schlicht und einfach nicht möglich, neben
seiner Ordinationszeit
noch alle 45 Hausbesuche durchzuführen; auch wenn der Patient
das Recht auf eine Visite am Krankenbett hätte.
Doktor J. ist niedergelassener
Internist. Er beginnt regelmäßig um 6 Uhr zu ordinieren, damit
berufstätige Patienten
noch vor der Arbeit Arzttermine wahrnehmen können. Um diese Uhrzeit bittet
er einen 39-jährigen Mann,
sich zwei oder drei Minuten zu gedulden, bis er eine eben abgeschlossene
24-Stunden-Blutdruckmessung
ausgewertet hat. "Herr J., aber ich habe meine
Zeit nicht gestohlen", antwortet der Patient eher schroff.
Doktor J. versucht die angespannte frühmorgendliche Situation zu
entschärfen: "Aber zwei Minuten haben Sie
schon Zeit, oder?" Daraufhin rastet der Handelsangestellte völlig
unvermittelt aus und beschimpft Doktor J.:
"Sie Affenschädel, was bilden Sie sich ein!"
Und als Doktor J., nunmehr besonders freundlich, den Patienten
ersucht,
sich zu entschuldigen, droht dieser: "Herr J.,
wenn Sie wollen, kriegen Sie eine Abreibung, die Sie nicht so schnell
vergessen werden!" Dann springt er auf und brüllt im
Hinausgehen: "Stecken Sie sich Ihren
Blutdruckapparat
in den ... !" und verschwindet um 6:08 Uhr, ohne die
honorarpflichtige Untersuchung bezahlt zu haben.
Natürlich sind solche Wortwechsel in
Arztpraxen nicht an der Tagesordnung, aber sie kommen mit
erschreckender Regelmäßigkeit vor. Und immer öfter fragen sich Ärzte,
welchen Schutz sie eigentlich
vor aggressiven, aufbegehrenden Patienten
haben. Ein Zufall, dass immer mehr niedergelassene
Ärztinnen und Ärzte Sicherheit in einem in Griffweite aufbewahrten
Pfefferspray suchen?
Im oben beschriebenen Fall wird der
Patient einfach den nächsten Arzt aufsuchen.
Das System erlaubt es, es sieht Sanktionen nur für aus der Rolle fallende
Ärzte vor.
Eine zweite, dritte, x-te Meinung einzuholen wird jedem Patienten
zugestanden.
Zum noch besseren Fachmann zu gehen. Die Finger-, Fuß-, Schmerzambulanz,
den Kniespezialisten, den Fachmann für die Haut, in der man sich nicht
mehr wohl
fühlt, aufzusuchen. Immer mit rechtlich gestärktem Rücken.
Das Recht auf
beste Medizin wird mit dem Recht auf den
besten Arzt verwechselt.
Und wer ist das überhaupt? Um dieser Frage aus dem Weg zu gehen,
bemüht sich der
Gesetzgeber verzweifelt, durch strenge Normen und Raster alle Ärzte gleich
gut zu machen.
Ein weiterer vergeblicher Kampf gegen Windmühlen. Denn wenn alle Ärzte
eines Landes
einmal gleich sind, wird es keinen herausragenden mehr geben können.
Und vergessen wird dabei eines:
Die Qualität eines Arztes entsteht erst
in der individuellen Arzt-Patient-Beziehung.
Vertrauen ist nicht normierbar. Es gibt kein Recht auf Vertrauen,
sondern nur ein Bemühen darum. Ein Bemühen, das nur
von Arzt und Patient gemeinsam ausgehen kann.
"Doctor-Hopping",
also das häufige Wechseln von Ärzten, ist eine weitere Folge der
allgemeinen
Verunsicherung. Wenn zwei Ärzte nicht die gleiche Meinung zu einem Fall
haben, muss sich
einer von ihnen irren, so lautet der anscheinend logische Schluss - aber
niemand gibt dabei
zu bedenken, dass es verschiedene Wege der
Heilung geben kann. Eher wird noch
eine weitere Stelle befragt, "ins Vertrauen gezogen". Vertrauen, das
diesen Namen
schon lange nicht mehr verdient.
Oder die Patienten machen sich selbst zum Arzt und
stellen ihre eigene Diagnose.
Einer zunehmend verunsicherten, von gesetzlichen Verpflichtungen
eingeengten und zermürbten
Ärzteschaft steht eine vor Selbstvertrauen und Rechten strotzende
Patientenschaft gegenüber,
die in ihrer Begierde nach Krankheit und Heilung kaum noch zufrieden
gestellt werden kann.
Ohne jedes Schamgefühl werden dabei fachlich wie grammatikalisch völlig
falsche und irreführende
Begriffe wie "Magengastritis", "Herz-EKG" oder gar "Hubschraubervirus"
(statt Helicobacter,
und der ist kein Virus, sondern ein Bakterium) verwendet - und wehe, ein
Arzt stößt sich daran.
Der Arzt soll vor allem jede Befindlichkeitsstörung ernst nehmen und ja
keine mögliche Erkrankung
(und wir wissen: Nichts ist unmöglich!) übersehen. Sonst drohen Patienten,
Rechtsanwalt und Imageverlust.
So werden laufend kostspielige Untersuchungen ohne Nutzen für den
Patienten durchgeführt.
Es gibt zum Beispiel eine irrational hohe Zahl von MRT-Untersuchungen der
Lendenwirbelsäule bei
Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Die erhobenen Befunde bleiben ohne
therapeutische Konsequenz,
die Behandlung ohne MRT-Befund wäre weitgehend dieselbe. Aber immer mehr
Ärzte sichern sich so
rechtlich ab, gerade durch die unzähligen Bildgebenden
Untersuchungstechniken wie MRT oder Röntgen.
Zur Rechtfertigung könnte man höchstens noch in die Waagschale werfen,
dass durch solche
an sich unnötigen Untersuchungen hin und wieder durch Zufallsbefunde
ernste Erkrankungen
entdeckt werden und so das eine oder andere Leben gerettet werden können.
Vorübergehend
wohl nur, aber immerhin - denn die Sterblichkeit des Menschen beträgt
immer 100 Prozent.
Und um welchen Preis bezahlen wir diese Zufallserfolge? Wie viele gesunde
Probanden
müssen untersucht werden, um einem Menschen das Leben zu retten? Wie viele
Lungen-
röntgen müssen angefertigt werden, um ein Lungenkarzinom zufällig zu
entdecken?"
 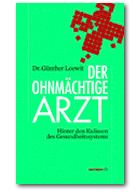
Günther
Loewit
(b.1958)
Österreichischer Arzt, Autor
Buch: „Der
ohnmächtige Arzt. Hinter den Kulissen des Gesundheitssystems“
Kapitel: Die verwaltete Medizin. Unterkapitel: Die Macht der Juristen.
Misstrauische Patienten, unerfüllbare Vorgaben. Seite 127-131
HAYMON 2010
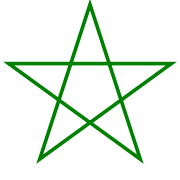
Gesundheit um welchen Preis?
"Unsere Gesellschaft steht letztlich vor einer philosophischen
Fragestellung:
Es ist zwar unmöglich, das
Recht auf Gesundheit und
ein langes Leben
einzuschränken oder in Frage zu stellen.
Aber wo werden die finanziellen Grenzen gezogen?
Von wem? Und vor allem: Wann? Und mit welchem Recht?
Wie lange wird Geld zur Verfügung stehen, um das Recht auf Gesundheit
für alle zu sichern? Wie lange werden immer weniger junge Menschen
ihren Obolus für die Gesundheit einer überalternden Gesellschaft
entrichten?
Wann wird zum ersten Mal laut überlegt werden, wie alt ein Mensch werden
muss?
Und wozu?
Natürlich sei jedem Menschen ein langes, gutes und gesundes Leben gegönnt,
gewünscht.
Aber die Frage nach der finanziellen Machbarkeit
muss erlaubt sein.
Doch so lange noch kein Murren, kein Stöhnen der Steuerzahler zu hören
ist,
wird munter weiter untersucht, vermeintliches Wohlbefinden in Frage
gestellt.
Gutes Geschäft mit der Angst gemacht.
Krankenkassendefizit hin oder her, die Bilanzen der privaten
Krankenhausbetreiber zeigten 2009,
wie eine jüngst in Deutschland veröffentlichte Studie belegt, trotz der
Krise ein traumhaftes Wachstum.
Zufällig, ohne gezielte medizinische oder politische Absicht wird
untersucht und geforscht.
Und argumentiert, dass die frühzeitige Erkennung und Behandlung von
Krankheiten
dem Staat sparen helfe. Nur über die Kosten dieser Vorgangsweise wird
geschwiegen.
Eine Regel aus dem Wirtschaftsleben besagt: Mit 20% der zur
Verfügung stehenden Ressourcen
sind erfahrungsgemäß 80% der gestellten Aufgaben zu bewältigen. Für die
restlichen 20%
müssen 80% der zur Verfügung stehenden Mittel aufgewendet werden.
Diese Faustregel eignet sich
sehr gut, verschiedene Prozesse im Gesundheitssystem
aus finanzieller Sicht zu beleuchten. 80% Redundanz und Ballast für 20%
Effektivität.
Die logischen Konsequenzen aus dieser Vermutung zu ziehen,
verbietet sich in der Praxis
von selbst. Denn die Klagefreude von spezialisierten Anwälten hängt wie
ein
Damoklesschwert in jedem Behandlungsraum.
Frau Anna F. ist 72
Jahre alt. Bei einem routinemäßigen EKG wird Vorhofflimmern
festgestellt.
Da die Dame außerdem übergewichtig ist und an erhöhtem Blutdruck leidet,
eröffnet ihr der Internist
Doktor H., dass zur Vermeidung von Schlaganfällen, wie sie bei Patienten
mit Vorhofflimmern vorkommen
können, eine Blutverdünnungstherapie eingeleitet werden muss. Aber bevor
er diese Behandlung beginnen kann,
müsse zuerst eine Magenspiegelung sowie eine Augenuntersuchung
durchgeführt werden, um möglicherweise
bestehende Geschwüre oder Gefäßschäden, welche unter der geplanten
Behandlung zu bluten beginnen könnten,
auszuschließen. Gewissenhaft klärt er Frau F. über die Notwendigkeit der
anstehenden Maßnahmen und die
möglicherweise auftretenden Nebenwirkungen und Komplikationen auf. So, wie
es das Gesetz verlangt und er es
in den entsprechenden Fortbildungen gelernt hat.
Aber Frau F. verweigert die Unterschrift am Aufklärungsbogen.
Das sei ihr alles zu gefährlich, sie sei mit ihrem Leben, so wie es ist,
zufrieden und lehne alle vorgeschlagenen
Untersuchungen und Behandlungen ab. "Dann können Sie aber jederzeit
einen Schlaganfall bekommen", warnt H.
noch einmal. Macht in seiner Not der verunsicherten Patientin Angst,
um die vorgesehene "State-of-the-Art"-Therapie
zur Anwendung bringen zu können. Frau F. wird noch einmal nachdenklich,
erwägt ein Einlenken. "Aber was ist,
wenn ich eine Gehirnblutung bekomme und mein Blut nicht mehr richtig
gerinnt?" Doktor H., an diesem Punkt
selbst verunsichert, sagt, was Ärzte früher nie gesagt hätten: "Ja, das
Risiko müssen Sie selbst tragen."
Worauf Frau F. endgültig entscheidet, so wie bisher weiterzuleben. Nur mit
neuen Ängsten, die sie bis zu
jenem Augenblick nicht hatte. Im Laufe der folgenden Wochen erhält sie von
ihrem Hausarzt
ein Antidepressivum verordnet."
Günther Loewit (b.1958, österreichischer Arzt, Schriftsteller): „Der
ohnmächtige Arzt. Hinter den Kulissen des Gesundheitssystems“
Kapitel: Die verwaltete Medizin. Unterkapitel: Die Macht der Juristen.
Gesundheit um welchen Preis? Seite 131-133
HAYMON 2010 [Ergänzungen]
|